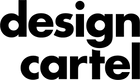Oskar Schlemmer – der geheimnisvolle Bauhaus-Künstler

Oskar Schlemmer war Maler, Bildhauer und Bühnenbildner. Von 1921 bis 1929 arbeitete er als Meister am Bauhaus in Weimar und Dessau und gestaltete unter anderem 1922 auch das weltbekannte Bauhaus Logo. Im Fokus seiner Werke stand die Darstellung der menschlichen Figur im Raum. Bekannt wurde Schlemmer vor allem durch die Bauhaustreppe aus dem Jahr 1932. Wir bieten Ihnen in unserem Shop eine breite Auswahl an Bauhaus Postern von Oskar Schlemmer und anderen wichtigen Vertretern der Schule.

Oskar Schlemmers Anfänge als Maler in Stuttgart
Oskar Schlemmer wurde 1888 in Stuttgart als das jüngste von sechs Geschwistern geboren. Nach dem frühen Tod seiner Eltern Mina Neuhaus und Carl Leopold Schlemmer lebte er bei seiner älteren Schwester. Aus finanziellen Gründen brach er mit 15 Jahren die Schule ab und begann eine Ausbildung zum kunstgewerblichen Zeichner. Schlemmer bekam ein Stipendium an der Stuttgarter Akademie für Bildende Künste. Er wurde 1913 Meisterschüler bei Adolf Hölzel, einem bedeutenden deutschen Maler der Abstraktion, und Wegbereiter der Moderne. In dieser Zeit lernte Schlemmer auch das Tänzerpaar Albert Burger und Elsa Hötzel kennen, durch die er die Liebe zum Bühnenwerk entdeckte.In Zusammenarbeit mit dem Tänzerpaar entstanden erste Skizzen für sein später berühmtes Werk, das Triadische Ballett. 1916 kam es zur Teil-Uraufführung, am 30. September 1922 fand die Uraufführung in Stuttgart statt. Das Triadische Ballett ist ein experimentelles Ballett.

Der Bauhaus-Meister
Im Herbst 1920 heiratete Oskar Schlemmer seine Frau Helena Tutein, die von da an „Tut Schlemmer“ genannt wurde. Die beiden bekamen drei Kinder. Noch im Jahr der Heirat wurde Schlemmer ans Bauhaus nach Weimar berufen. Dort übernahm er die Leitung der Werkstatt für Wandmalerei, später die für Holz- und Steinbildhauerei. Es beginnt Schlemmers kreativste Periode. Seine Bühneninszenierungen und Ausstattungen machen ihn weltweit bekannt. Seine Kunst lässt sich dabei keinem der bisherigen Stilrichtungen zuordnen. Ein Leitbild, das sich durch seine Kunstwerke zieht, ist der „Mensch als Maß und Mitte“. Mit der Tischgesellschaft von 1923 führte er ein neues Bildmotiv ein: die Rückansicht von Figuren. Diese finden sich in seiner Kunst immer wieder, zum Beispiel in der Vorübergehender von 1924/1925. Er verzichtet bei seinen Figuren auf physiologische Besonderheiten, die sie als Individuen erkennbar machen. Seine Figuren gleichen Gliederpuppen, die eher homogen und austauschbar sind. „Ich will Menschen-Typen schaffen und keine Porträts, und ich will das Wesen des Raumes und keine Interieurs“, so Schlemmer.
Die Bauhaustreppe
Ab 1931 entstand eine Reihe von Kunstwerken, die Treppen und Geländer zeigten, wie beispielsweise Gruppe am Geländer von 1931. Schlemmers Vorliebe für Geländer hatte neben einem künstlerischen auch einen psychologischen Hintergrund. Das Geländer verlieht den Bildern nicht nur eine Struktur, sondern symbolisiert auch eine Art Stütze, einen festen Halt. Das Geländermotiv steht für eine feste Ordnung, die sich dem Chaos und Zerfall entgegensetzt. Aufgrund der politischen Krisensituation 1930 drückt Schlemmer damit das vorherrschende Zeitgefühl aus. „Wir brauchen Zahl, Maß und Gesetz als Wappnung und Rüstzeug, um nicht vom Chaos verschlungen zu werden“, forderte Schlemmer. Seine berühmte Bauhaustreppe von 1932 wurde zum Wahrzeichen der Jugendkult-Bewegung des 20. Jahrhunderts. Darauf sind im Zentrum des Bildes drei turmartig gestaffelte, aufwärtsstrebende Rückenfiguren zu sehen. Mehrere andre Figuren sind im Anschnitt erkennbar. Das Motiv der Treppe soll den Weg in eine „lichtere Zukunft“ symbolisieren.

Kunst im Verborgenen
Nach der Machtergreifung Hitlers werden Schlemmers Werke – wie die vieler anderer Künstler – als entartete Kunst entwertet. Seine Bilder werden aus den Museen entfernt und vom Staat beschlagnahmt. Er lebte mit seiner Familie zeitweise zurückgezogen auf dem Land in Baden nahe der Schweizer Grenze. Als das Ersparte knapp wurde, begann er in einem Malergeschäft zu arbeiten. Er kümmerte sich um Ausmalungen an Bauten, Tarnanstriche von Militärflugplätzen und Industrieanlagen. 1940 siedelt er nach Wuppertal über und arbeitete mit anderen Künstlern in einer Lackfabrik. Dort probierte er die künstlerische Verwendung der Lackfarben und begann mit einer neuen Stilrichtung, die er in 18 Fensterbilder zusammenfasste. Doch die vielen Auftragsarbeiten und wenigen künstlerischen Werke der vergangenen Jahre, haben ihm körperlich und seelisch zugesetzt. Er leidet an Gelbsucht und Diabetes. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten stirbt Oskar Schlemmer am 13. April 1943 in einem Sanatorium in Baden-Baden an einer Herzlähmung.
Oskar Schlemmers Nachlass
Die Witwe Schlemmers hat den Nachlass ihres Mannes der Staatsgalerie Stuttgart übertragen. Im Stiftungsvertrag wurde festgeschrieben, dass das Archiv dazu dienen soll, den Nachlass Oskar Schlemmers wissenschaftlich zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unter dem Titel Oskar Schlemmer – Visionen einer neuen Welt eröffnete 2014 die Staatsgalerie eine umfassende Retrospektive zu seinem Werk. Der mit 25.000 Euro dotierte Große Staatspreis der Bildende Kunst des Landes Baden-Württemberg trägt außerdem zu Ehren des Künstlers dessen Namen.